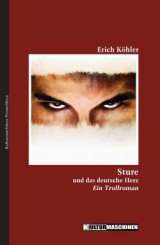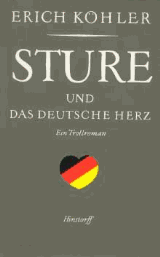
»Der Standhafte«
von Gabriele Lindner (Dezember 2005)
Annäherung an einen Autor mit Hilfe seiner Romanfigur
»Mythos, Utopie und Rapsode«
»Sture«-Rezension von Jürgen Verdofsky (1991)
Zur Geschichte des Romans schreibt sein Autor in
»CREDO oder ›Wie gleiches Streben Held und Dichter bindet‹«
»Rapport«
Seit Abschluß der Vereinbarung
(zwischen dem Schriftsteller, Herrn Erich Köhler, und dem VEG Tierproduktion Radensdorf, Kreis Lübben)
habe ich
1. den ersten Teil der Romantrilogie "Trollbuch" vorgelegt, im VEG gelesen und mit Brigademitgliedern, Lehrern aus der Patenschule, einem Lektor vom Hinstorff Verlag und Kollegen aus dem Schriftstellerverband, Bezirk Cottbus, diskutiert (...)
3. Da die Arbeit am Hauptwerk studienhalber nicht vorankam, so erfaßte mich eine Art Mißerfolgspanik. Ich hatte den Ergeiz, meine materielle Bilanz im VEG positiv zu gestalten. (...)
4. Um zur Frage Krieg und Frieden nicht stumm zu bleiben, fertigte ich aus einem Kapitel im Trollbuch: "Der Friedenskaiser" einen dramatischen Text an. Da sich kein Theater für dieses Stück engagierte, machte ich aus dem Schau- ein Hörspiel, das derzeit unter dem Titel "Sternstunde" bei Radio DDR produziert wird. (...)
6. Nicht zuletzt habe ich für das Trollbuch umfangreich Studien getrieben. (...)
(Der Text "Rapport" ist wohl aus dem Jahre 1985)
im Kapitel "Epilog" (in CREDO) berichtet er:
Der Roman "Sture und das deutsche Herz" erschien im März 1990. Die Buchpremiere fand im hallend leeren Versammlungsraume statt. Es war die letzte Kulturveranstaltung im VEG. Draußen zwischen den Boxen trieben sich westdeutsche Viehaufkäufer herum. (..) Politisch wie ökonomisch ging es nicht um die Erhaltung, sondern um die Vernichtung eines sozialistischen Großbetriebes.
Buchklappen-Text
Das geht schon Jahrhunderte so, oder auch ein Jahrtausend; „alle paar Generationen kommt einer herauf, hat Augen wie ein Satan, ist nicht nach Schweden Art, wird niemals Bauer, bleibt nicht lange im Lande. Diese Bälger werden Spielleute, Gaukler, Scharlatane, Galgenvögel. Sie verkommen in der Welt". Der aus der Art geschlagene Visionär aus Almskulle durchlebt alle seine zurückliegenden Leben, sieben an der Zahl, ehe er nach Verschwinden des Pastors Läskevatten nach Kiruna verbannt wird, in den hohen Norden. Von dort flieht der Bauernsohn und Bergmann in die deutsche Übergangsrepublik der 20er Jahre. Er beobachtet den Wettlauf der Parteien, führt, oft rätselhaft, das Wort auf Geheimsitzungen und bei Seancen, beschwört Schadgeister, Gelichter, Gelumpe aus einer alten niederländischen Schrift.
Sture verläßt das Reich der tausend Haftanstalten; als Türsteher hört er eine Stah3 in ihren Trümmern singen, Madrid. Seiner Politoblate, einem bemalten Bierfilz, wie einem Kompaß folgend, seinem Zossen Karl vertrauend, begibt sich der Schwede, geblendet, auf eine Zeitreise in die Vergangenheit.
Salzsee links, Sandmeer rechts, wüste Wohnstätten hinter, verwüstende Heere vor sich, reitet die abgerissene Gestalt prophetengleich in Jerusalem ein; Sture zieht es zum Dreikönigstreffen nach Teheran, in einem russischen Gefangenenlager predigt er sich vor die Fäuste gefangener Landser. So taumelt Sture von einer Schmach in die andere. Sprengtechniker, Bremswerker schließlich in der neuen halben Republik, bleibt der mit Not Überlebende doch immer der radikale Vorpreller Sture. Meistens auf der falschen Seite, wird er selbst Opfer eigener verderblicher Fingerzeige und Orakelsprüche. Ganz zum Schluß schwebt Sture, der fliegen lernen wollte, wirklich. Er landet auf der Mauerkrone, in unmittelbarer Gegenwart. (Und dies, wohlgemerkt, stand '89 schon im Frühjahr so im Manuskript.) In Erich Köhlers grimmiger, erstaunlich klarsichtiger Heerschau von Geistesgeschichte, Geschichte und Geschichten wird auf eigenwillige Art alles Bild, Dichtung, Deutung, zur Sprache gebracht, Sprache.
Mythos, Utopie und Rapsode
"Sture"-Rezension von Jürgen Verdofsky
abgedruckt in der "Frankfurter Rundschau" vom 6.11.1991
Erich Köhler steht nicht immer mit beiden Beinen auf dem Boden. Als phantastischer Erzähler kann er sich das leisten. Unvergleichlich aber ist er als enzyklopädischer Grübler. Seine Bildung ist autodidaktisch, also gründlich. In der Wahrnehmung kennt er die Pedanterie eines Forschers. Seine Phantasie verhält sich zum Gedanken osmotisch, das heißt, sie wird ihm schon mal geopfert, um im nächsten Moment das schwer Denkbare wieder chimärenhaft zu provozieren. Und er weiß, warum: "Ein Dichter ist ein Mensch, der in der Praxis an seiner Phantasie scheitert.. "
Nun versteht sich "Praxis" für Köhler in der DDR des Bitterfelder Weges auch als gesellschaftlicher Begriff, und der Autor hat sich als früherer Bergmann (Wismut) und Landarbeiter gegen das Idealbild vom "schreibenden Arbeiter" zu wehren. Konsequent entzieht er sich jeder Milieu-Erwartung. Der Bitterfelder Mummenschanz ist noch in vollem Gange, als Köhler im Tagebuch notiert: "Ich bin vom Dichten zum Denken übergegangen." Und das tut er gründlich im Angesicht eines verwunschenen Stoffberges. Solange er schreibt, kommt er immer wieder auf das Scheitern der Utopie von einer gerechten Gesellschaft der Freien und Gleichen zurück.
Benjamin sagt: "Der Grübler, dessen Blick, aufgeschreckt, auf das Bruchstück in seiner Hand fällt, wird zum Allegoriker." Blickt Köhler auf die Bruchstücke seines Gegenentwurfs zum real existierenden Sozialismus, weiß er, es ändern sich allein die Mittei der Vergleichung, die Kategorien unseres Begreifens weniger. Als Autor erprobt er die Mittel. Das führt ihn vom Schauerdrama, "Der Geist von Cranitz", über abenteuerlich flutende Bilder, "Reise um die Ende in acht Tagen", zu grotesk-phantastischen Geschichten, "Krott" und "Kiplag" (früher Rotbuch, heuer Hinstorff). Mit seinem Essay "Nichts gegen Homer" bringt er 1986 die in Ost-Berlin niedergelassenen Altphilologen gegen sich auf. Seitdem wissen wir, Köhler holt sich Vorrat für sein Denken mit Vorliebe bei den großen Alten. Aber er geht noch weiter, kommt zum Mythos, den er als ein Nachdenken über das Sein versteht. Es wird ihm undenkbar, sich im Mythos zu bewegen, ohne ihn in Gegenwart zu verwandeln.
In seinem neuen 450-Seiten-Werk "Sture und das deutsche Herz" sind wir mitgerissen von der völligen Unbekümmertheit des Verfahrens. Ein nordischer Troll führt uns über die Königsebenen und durch die Katastrophen unseres Jahrhunderts. Bevor aber dieser Sture Thorson als Disputant der europäischen Zeitgrößen beginnen darf, lernen wir seine sieben Vorleben kennen. Prolet in Paris des Revolutionsjahres 1848, Barbarossa für rebellierende Bauern und kürende Fürsten, mit Geisterwissen promovierender Scholar, eifernder Seelsorger am Gral der Parzival-Runde, Schlagetot unter Salier-König Chlodowech, kastrierter römischer Seher und ergrauter Vorzeit-Schamane voller giftiger Zweifel - das sind die Rollen der Köhler-Trolle im O-Menschheits-Spektakel. Und jeder dieser Heldendarsteller scheitert durch Geradlinigkeit oder Sendungsbewußtsein. Aber all diese Erfahrungen der Altvorderen hat StureVIII noch vor sich.
Nur mir der Kenntnis der "Edda" gerüstet, schleicht sich unser Sture in das revolutionäre dampfende Berlin von 1919. Als er mit Edda-Sprüchen streikende Arbeiter zu beruhigen versteht, soll sein gleichnishafter Redestil unter Partei-AIchimisten, heißen sie nun Scheidemann oder Thälmann oder Hitler Schule machen. Auch für die Maxime der Wirtschafts-Weisen, "was haben wir nach unten anzubieten, damit die Leute mitmachen", scheint dieser Troll einiges leisten zu können. Aber halt was redet dieser Sture da von Freien und Gleichen? Sturmbann-Diabolus Schnittke nimmt sich seiner an und bläst dem Troll im Bürgerkriegs-Spanien mit einem Pistolenschuß das Augenlicht aus. Der Blinde ist aus dem Schrecken der Zeit gehoben, er trifft auf Empedokles und Sophistes und führt ihn in die antiken Philosophenschulen ein. Aber weder die Alliierten noch das geschlagene deutsche Heer bedürfen eines Philosophen oder gar blinden Sehers. Stures Zuversicht gilt der Nachkriegszeit.
Des Werkes dritter Teil beginnt. Die Westalliierten und Adenauer flicken am Restdeutschland. Der Troll versucht sich bei Ulbricht als Aufklärer und wird in den Uranbergbau der Wismut AG geschickt. Zur Atombombe fällt selbst einem Troll nur ein: "Muß das sein?" An der Gewerkschaftsschule vermehrt Hermann Duncker das Edda-Wissen und das des Sophistes um das marxistische. Die Folge: Sture schafft am 17. Juni mit „Arbeitsromantik" Verwirrung: "Arbeitet einen Tag freiwillig und ihr seid andere Menschen" Streng wird er abgemahnt. Damit erregt der Troll als politisches Weltkind wieder das Interesse seiner westlichen Industriebekanntschaften. Doch bei näherer Prüfung heißt es: "Dich gönnen wir unseren ärgsten Feinden." Bei denen orakelt unser Troll, und Honecker versteht "Bahnhof". Wie gehabt, der blinde Seher wird verlächeIt. Die Anweisung für den Apparat: "Ermattet ihn."
Doch damit ist Stasiewiesel Klaubermann überfordert. Der greise Troll verdirbt jetzt unschuldige Kinder, "die Tat ist gefragt nicht der Lohn", und formt Plastiken nach der Manier des Empedokles. "Da wuchsen viele Geschöpfe heran mit Doppelantlitz..." Der Kreis westlicher Wirtschaftsdenker ruft erneut, doch diesmal wird die Mauerdurchfahrt gestört. "Republikaner" (!) werfen unseren Troll auf die Mauerkrone. Und da will er bleiben: " ... ich hab mich nirgendwo so wohl gefühlt wie jetzt gerade hier."
Also doch ein Seher, denn Köhler hat das Manuskript im März 1989 dem Rostocker Hinstorff Verlag übergeben. Das Buch erscheint natürlich nach der Wende. Wer hätte vorher das Orakel zu deuten gewußt? Hat Grübler Köhler den nahen Untergang erspürt?
Wie auch immer, in diesem Antiroman konkurriert ein Philosoph mit dem Erzähler. Er begegnet uns eis Rhapsode. Allerdings nicht so streng, daß für Situationsgroteske kein Raum bliebe. Da der Mythos nicht in Konkurrenz zur Utopie treten kann, behilft sich Köhler mit Universalgeschichte. Daß dadurch der Erzählfluß nicht selten überlagert wird, nimmt er in Kauf. Und wir wissen bereits, der Autor hat die Allegorie auf seiner Seite. Für dieses Buch weiß ich auch zurückblickend keinen Vergleich.
Apropos proletarische Dichter aus dem deutschen "Arbeiter- und Bauernstaat": Wolfgang Hilbig ist angekommen, Paul Kratznik verschollen und Erich Köhler ungehört?
Erich Köhler:
Sture und das deutsche Herz. Ein Trollroman.
Hinstorff Verlag, Rostock 1990,448 Seiten, 34 DM
abgedruckt in Kommunistische Arbeiterzeitung KAZ NR.215 (Febr.1991)
Das Trollbuch - eine Rezension
"Wer ist wer? Da ist das eine gleiche Wort des anderen Widersacher. Weißt du, Mann auf der Straße, wer dein Widersacher ist? Weißt du es aber, so unterscheide dich bewußt als sein genaues Gegenteil. Ist er ein Bilm, so sei ein Heinz. Denn kriechst du bei ihm unter, lösest du die Formel nicht. Er macht dich zum Automaten, der nur funktioniert, wenn in den Trichter Silberlinge eingegeben werden. Mache du dich zum Menschen, spucke ihm seine gepunzten Prägestücke ins Gesicht. Er haut dir nach getaner Arbeit ja doch auf den Scheitel, und stößt dich in die Seiten, um durch Erschütterung die eingegebenen Münzen wieder loszurütteln." Und mitten in einer Demonstration, er mit dem Megaphon am Mund, weiß er, was er den Menschen zu sagen hat: Was wahre menschliche Arbeit ist.."unbezahlte Arbeit zum Nutzen der Gesellschaft", Arbeit, "nicht nach mechanistischen Motiven, sondern nach Vernunft und Würde", wozu die allgemeinen Voraussetzungen zu schaffen sind. Wann das sein soll? Erich Köhlers Sture sagt es uns: "Die Dimension der Utopie ist nicht die Ferne, sie ist das Hier und Heute allzumal...".
Das Buch ist keine Schonkost, es verlangt viel vom Leser, verlangt, daß man sich einstellt auf eine Sprache, die verkürzt und in die Länge zieht, mit Wörtern experimentiert und neue erfindet; es verlangt, daß man sein Geschichtswissen parathält und seine Meinung wetzt an der Art und Weise, wie der Troll Sture da durchfegt.