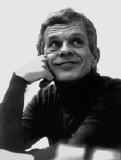Ästhetik der Kunst
Auszug aus Kapitel 3
Ästhetische Wertung und
Wahrheitsanspruch der Künste
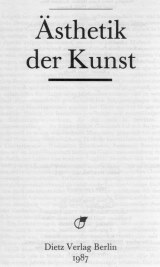
Autoren:
Erwin Pracht (Leiter des Autorenkollektivs), Michael Franz, Wolfgang Heise, Karin Hirdina, Rainhard May, Günter Mayer, Ulrich Roesner
Redaktion:
Michael Franz, Karin Hirdina, Rainhard May, Erwin Pracht, Ulrich Roesner
1. Kapitel:
Ulrich Roesner, Günter Mayer
2. Kapitel:
Erwin Pracht, Karin Hirdina, Rainhard May
3. Kapitel:
Michael Franz
4. Kapitel:
Karin Hirdina, Erwin Pracht / Wolfgang Heise
Exkurse: Wolfgang Heise
5. Kapitel:
Erwin Pracht
Ästhetik der Kunst / [Autoren: Erwin Pracht (Leiter d. Autorenkoll.)...]. -
Berlin: Dietz Verl., 1987. - 683 S.
ISBN 3-320-00920-6
Lektoren: Andrée Fischer, Ursula Schirmer
Korrektoren: Sigrid Hornig, Konstanze Ultsch
Umschlag: Gerhard Medoch
Typographie: Sylvia Claus
Printed in the German Democratic Republic
Herstellung: INTERDRUCK Graphischer Großbetrieb Leipzig,
Betrieb der ausgezeichneten Qualitätsarbeit, III/18/97
3.3.
Die Erhabenheit des Widerstands
Daß Leben und Sterben, Denken und Dichten des Seneca ein heute wieder aktuelles Thema sein kann, beweisen das Seneca-Stück und der dazugehörige Essay von Peter Hacks. Hacks hält es angesichts der gebündelten, zum Teil extrem zugespitzten Widersprüche in der Epoche des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus im Weltmaßstab nicht für überflüssig, sich mit Senecas Stoizismus und dessen inneren Widersprüchen zu beschäftigen. Nicht ganz zutreffend nennt Hacks Seneca den Vertreter einer Humanitätslehre, »die mit der römischen Wirklichkeit allenfalls in der Hinsicht zu tun hatte, daß sie sie aus ihrer Rechnung ausschloß« . /44/
Doch die allgemeinen Normen des Verhaltens, die Seneca empfiehlt, sind dieser Wirklichkeit entsprechend modifiziert. Als Normen einer vor allem naturphilosophisch begründeten Vernunft sind sie gegen die geltenden Normen der Unvernunft, des krankhaften Abfalls von der gesetzmäßigen Ordnung der Natur gerichtet: Seneca lehrt eine illusionslose, nüchterne Betrachtung der römischen Wirklichkeit, während er gleichzeitig die Illusion verbreitet, man könne sich durch Affektlosigkeit, Gefaßtheit, Selbstbeherrschung von der Wirklichkeit unabhängig machen, indem man Mühen und Leiden tapfer und geduldig auf sich nimmt: eine innere Souveränität, die in krassen Gegensatz geraten kann zu äußerer Ohnmacht. Insofern erscheint es als einigermaßen befremdlich, wenn Hacks in seinem Seneca-Essay schreibt: »Seneca, wie er oder man sagt, verschied in jener erhabensten unter den Haltungen, die wir einfach Haltung nennen. Haltung ist die Vorwegnahme menschlicher Selbstbestimmung auf geschichtliche Lagen, auf Lagen also, die keine anderen sein können als aufgezwungene; der Mensch, der Haltung hat, verhält sich als Erwachsener, während die Umstände die Menschheit noch gängeln. Alles mündige und eigenverantwortliche Betragen ist Vorwegnahme, ist eine Form der Hoffnung. Anders als in die Aufführung von Gesellschaften, die durch zu viel Siege oder zu viel Niederlagen dahin gebracht sind, sich seelisch zu vernachlässigen, paßt die Haltung Haltung in den Wertzusammenhang des Bolschewismus. Wir benötigen ihrer im Kampf, im Unglück und im Glück ...« /45/. Hacks sucht sie aber künstlerisch sinnfällig zu machen im Tod. Selbst wenn man die ironischen Brechungen berücksichtigt, die in Hacks' Texten immer mitspielen, erschreckt die Abstraktheit der »Haltung Haltung«, zu der sich Hacks bekennt. Man kann auch nur schwer absehen vom inneren Zusammenhang von Haltungsmoral und Preußentum, womit sich Fontane ebenso auseinandergesetzt hat wie Thomas Mann im »Tod in Venedig«. Bezeichnend ist auch Hacks' Hinweis auf geschichtliche Lagen, die schlechthin als aufgezwungene verstanden werden. Doch Hacks betont zugleich, daß er die »Haltung Haltung« eingebunden wissen will in den »Wertzusammenhang des Bolschewismus« - so eingeordnet erscheint »Haltung« als rationale Selbstkontrolle, die kein isolierter Wert ist, sondern des Bezugs auf inhaltliche Grundwerte bedarf. Hacks äußert sich auch zu dem wiederholt vermerkten angeblichen Widerspruch zwischen Senecas Tugendlehre und seinen Tragödien, die im Grunde Dramen des Schrecklichen sind. »Senecas Trauerspiele sind beispielhaft für alle Niedergangskunst. Als einsamer Versuch, die Hervorbringungen der griechischen Klassiker fortzusetzen, zeigen sie die bezeichnenden Mängel schriftstellerischer Nachtreterei: Ursachendurcheinander und Fabelbeliebigkeit, Formwucherung und Formekel, Reizauftürmung und Wirksucht. Den Vorbildern hinzugefügt wird nur eines: eine langweiligste Breite im Bereich der Einzelheiten, insonders der unangenehmen. Solche Maßlosigkeit im Schmerzlichen vereinbart sich in der Tat schwer mit der selbstverständlichen Tüchtigkeit des wirkenden und der unerschütterlichen Sittenstrenge des ratschlagerteilenden Seneca. « /46/ In welchem Maße Seneca in seinen Dramen ein Bild der römischen Wirklichkeit gibt, ihren Sinnbefund, fragt Hacks nicht. In Hacks' Stück »Tod des Seneca«, das wie eine Boulevardkomödie mit geistreichen Dialogen und scharfen Pointen abläuft, in einer gehobenen Verssprache, die untergründig parodiert wird, wird die »Haltung Haltung« alltäglicher Wirklichkeit ausgesetzt und letztlich als gefaßte Hilflosigkeit anders als im Essay ad absurdum geführt. Das Schreckliche kleidet sich in eine philosophische Anfrage, in der Nero den von antineronischen Verschwörern als Mitwisser preisgegebenen Seneca zur Selbsttötung verurteilt: »Der Lehrling in der Tugend, der alle erhabeneren Begriffe seinem Meister verdankt, ist beim Wiederlesen von dessen Darlegung über das rechte Sterben des Weisen von nicht geringer Neugier befallen, ob solche Standhaftigkeit im wirklichen Leben so mustergültig sich antreffen lasse wie in den Rollen, die auf dem Pult liegen, und wünscht, bis zum Anbruch der Nacht Unterricht in dieser Frage zu erhalten .« /47/
Die Haltung, die Seneca bewahrt, ist keineswegs abstrakte Gefaßtheit, sondern Entschlossenheit, die auf höchstmögliche Entfaltung seiner geistigen Produktivität abgestimmte strenge Zeiteinteilung und planvolle Lebensführung bis zum äußersten zu verteidigen. Daran wird er jedoch ständig gehindert - durch eitle Besucher, selbstbewußte Handwerker, die frisch erwachte Streitlust seiner Frau. Der Plan widerlegt sich selbst. Das letzte Gastmahl, das den höchsten Fragen gelten soll, ist ein einziger Fehlschlag: Seneca wird zu lächerlichen Schutzbehauptungen genötigt, muß die Eitelkeiten seiner Frau und seiner Besucher befriedigen, sein Verleger will ihn um das Honorar betrügen. »Und statt vom Heilig-Hohen sprachen wir vom Sumpf«. Seneca stirbt mit der offenen Frage: »Wie kann man leben?« Wenn im Verlaufe des Stücks die Worte fallen: »Haltung ist der letzte Halt« /48/, dann ist das eine komische Pointe, die kaum mehr überboten werden kann: das Stück ist eine Tragikomödie der »Haltung Haltung«. Wenn in Aufführungen dieses Stücks nicht die Anwesenheit des Schrecklichen mitinszeniert wird, wenn den Zuschauern nicht immer wieder das Lachen im Halse steckenbleibt, dann wird es verfehlt.
Wenn in der »Ästhetik des Widerstands« der Widerstand Erhabenheit gewinnt, dann ist es etwas anderes als die von Hacks gerühmte Erhabenheit der »Haltung Haltung«. Die Ästhetik des Widerstands ist keine Ästhetik der Haltung. Weiss stellt dem Schrecklichen des Faschismus und Imperialismus nicht lediglich die subjektive Größe stoischer Selbstüberwindung entgegen, die passive Seite der Tapferkeit, die sich in der Geduld zeigt, in der auch die schrecklichsten Prüfungen ertragen werden. Bestand das Schreckliche darin, »daß da Mächte am Werk waren, Menschen in gewaltigen Mengen niederzumetzeln«, so lag das Erhabene bereits darin, »daß einige sich daran gemacht hatten, diesen Taten entgegenzuwirken, und das Denkwürdige daran war wiederum nicht, daß sie kaum vernehmbar, daß sie so unscheinbar waren, sondern daß es sie überhaupt gab, daß sie den Verfolgungen entgangen, daß sie nicht in die Fallen geraten waren, daß sie sich miteinander verständigten und geheime Wege zueinander fanden, um gemeinsam zu planen« . /49/ Nicht das Schreckliche ist daher das Wesentliche, das Ausschlaggebende, sondern der Widerstand. Darin liegt der entscheidende Unterschied zur Ästhetik des Schreckens. Nicht die Schockeffekte der Schreckensdarstellungen bestimmen das Wirkungskonzept, sondern die Ausstrahlung der Widerstandshandlungen. »Das Wichtige, das alles Überschattende war nicht das fortwährende Zerbersten und Zusammenbrechen, sondern die Anstrengung, mitten im Dröhnen, Geschrei und Röcheln auszuharren.« /50/
Dem Widerstand wohnte die konkrete Vernünftigkeit der Übereinstimmung mit der geschichtlichen Notwendigkeit inne. »Doch der Vernunft, als Leitfaden der Arbeit, widersprach vieles.« /51/ An der Schrecklichkeit des Schrecklichen bemißt sich die Erhabenheit des Widerstands, zu der daher auch Fehler und Anfechtungen gehörten. »Die Mängel mußten hinzugerechnet werden, denn mit ihren Schwächen und Unzulänglichkeiten waren sie, die sich hier verbargen, und sie, die im Land drüben aushielten, doch die einzigen, die sich aufgelehnt hatten, um den Gegner zu Fall zu bringen, und sie waren, bei jeder ihrer Bewegungen, aufeinander angewiesen.« /52/ All dies tut der Erhabenheit des Widerstands keinen Abbruch: Diese bemißt sich auch an der Tiefe der Verzweiflung, an der Schmerzhaftigkeit der Enttäuschungen, an der Auswirkung des Schrecklichen in den eigenen Reihen. In den Notizbüchern schreibt Peter Weiss über die Gestaltungsintention, die sich beim Schreiben des dritten Bandes entwickelte: »Von den bisher gewonnenen Begriffen einer Ästhetik aus, die auch Qualitäten wie Menschenwürde, Mut, Ausdauer berücksichtigt, Eigenschaften, die gerade jetzt (zu ergänzen wäre: gebraucht werden - Die Verf.), da vieles von dem, was wir erstreben, sich im Zerfall befindet, da der Glauben an einen Fortschritt, eine Besserung der Verhältnisse, fußend auf der materialistischen Geschichtsauffassung, von Zweifeln durchsetzt wird, wird versucht, die Erkenntnisse zur Anwendung zu bringen. Es haudelt sich also nicht länger um die Schilderung des Wegs zu einer Ästhetik des Widerstands, sondern diese Ästhetik liegt der gesamten Anschauung (Bericht, Schilderung) zugrunde. Der Blick wendet sich von dieser Ästhetik aus den Geschehnissen zu. Das Motiv des Widerstands ist in der Kunst, wie sie hier beschrieben wurde, von besondrer Wichtigkeit (steht an erster Stelle), da die Schwierigkeiten, die auf den Menschen lasten, ein solches Gewicht angenommen haben, daß es ihnen untragbar scheint.« /53/
Eine Auffassung des Erhabenen, die Schwächen und Unzulänglichkeiten, Rückschläge und Zweifel einschließt, steht durchaus in Einklang mit Pseudo-Longinos, der das Erhabene keinesfalls als makellos und unanfechtbar konzipiert hat. Bezogen auf die Literatur schrieb Pseudo-Longinos: »Bei dem Natürlich-Großen in der Literatur - hier fällt die Größe nicht mehr aus dem Rahmen von Notwendigkeit und Nutzen - müssen wir entsprechend folgern, daß derartige Menschen, auch wenn sie nicht fehlerfrei sind, sich weit über alles nur Sterbliche erheben. Alle anderen Eigenschaften erweisen sie als Menschen, das Erhabene hebt sie nahe an die Seelengröße des Gottes. Was fehlerlos ist, wird nicht getadelt, das Große aber zudem bewundert.« /54/ Das Erhabene hat weder mit übermenschlicher Makellosigkeit noch mit pedantischer Korrektheit etwas zu tun. Mit Fehlern behaftet, ist es zugleich das Nicht-Perfekte, Unfertige, entscheidend ist der produktive Impuls.
Das Erhabene ist etwas anderes als das Schöne; Pseudo-Longinos hätte den Begriff des Erhabenen nicht bemühen müssen, wenn das, was er darunter faßt, ohne weiteres im Begriff des Schönen aufginge. Es ist für Pseudo-Longinos vor allem das produktive Übermaß, das Hinausdrängende, Grenzüberschreitende, der Zug ins Unendliche, alles das, was das Schöne sprengt, das ja, geprägt durch die griechische Klassik, in der Form der Geschlossenheit gedacht wurde. Denkt man das Schöne dagegen auch in der Form der Offenheit, dann kann das Erhabene auch als besonders dynamische Form des Schönen verstanden werden. Auf der anderen Seite verarbeitet Pseudo-Longinos Realitätserfahrungen, die es schwer machen, überhaupt ein Gegenbild zu entwerfen - es muß der gesellschaftlichen Unordnung und Disharmonie, der Niedrigkeit in allen denkbaren Formen standhalten.
In der »Ästhetik des Widerstands«, spielt das Schönheitsproblem eine entscheidende Rolle, nicht nur als Problem der künstlerischen Gestaltung, worauf wir noch zu sprechen kommen, sondern in erster Linie als soziale Verhaltensqualität. Dieser Schönheitsbegriff wird keineswegs nur dadurch faßbar, daß ihn der norwegische Spanienkämpfer und Schriftsteller Grieg in einem charakteristischen Handlungszusammenhang als sein Bekenntnis, als persönliche Selbstbehauptungsformel, ausspricht: »Schönheit ist Handlung.« Das wäre zu wenig. Grieg fügt hinzu: »In der großzügigen Tat finden wir Harmonie.« /55/
Selbst wenn es fraglich ist, ob die schöne Tat schon im Widerstand realisiert wird, ist sie das Ideal, auf das alle Widerstandshandlungen unausgesprochen bezogen werden. Die Anstrengung, mitten im Dröhnen, Geschrei und Röcheln auszuharren, läßt Großzügigkeit im Handeln, auch im Denken und Fühlen, nur im Ausnahmefall zu. Hinzu kommt: »Auch der Haß gegen die Niedrigkeit /Verzerrt die Züge« /56/ - der Widerstand ist auch durch sein Gegenteil, das Niedrige und Schreckliche, gezeichnet. Da sind Verkrampfungen und Verzerrungen, Mißverständnisse und Verdächtigungen, Ignoranz und Indolenz. Es ist das Große an Peter Weiss' Roman, daß er auch die verhängnisvollen Irrtümer und Entstellungen in den eigenen Reihen zeigt, die Gefährdung der »dritten Sache«, die die Kämpfenden verbindet, durch Mißtrauen, Geltungsdrang und Selbstzerfleischung. Doch diese Widersprüche heben die Erhabenheit des Widerstands nicht auf: Es muß auch dem Widerschein des Schrecklichen, seiner Spiegelung in den eigenen Reihen widerstanden werden. Hier verbindet sich das Erhabene in besonderer Weise mit dem Tragischen. Ein so ungeheurer Druck lastet auf den Handelnden, daß die schöne Tat nicht zur Entfaltung kommen kann, doch als Ideal wird Schönheit nicht preisgegeben, sie ist die ungezwungene Einheit von Sinn und Sinnlichkeit im menschlichen Handeln, frei von Verkrampfungen, Verzerrungen, Eitelkeiten, Winkelzügen, von Engstirnigkeit und Fühllosigkeit.
Es gibt wenigstens eine Romanfigur, die in ihrem gesamten Denken, Fühlen und Handeln Schönheit ausstrahlt - das ist Lotte Bischoff. Ihre äußere Erscheinung ist eher unscheinbar, aber das ist für den auf Tätigkeit gegründeten Schönheitsbegriff sekundär. Als sie in schwedischer Abschiebehaft, die Auslieferung an die Nazis vor Augen, in Begleitung einer Polizeischwester die Stadt Stockholm besichtigen darf, ist es ihr unmöglich zu fliehen: »Es war, als sei sie beauftragt worden, im Zusammensein mit der Schwester eine, wenn auch geringe, Erziehungsarbeit zu leisten. Sie durfte die Schwester nicht enttäuschen und nicht in ihrem Glauben bestätigen, Kommunisten seien Betrüger und Lügner.« /57/ Diese menschliche Lauterkeit ist unfaßbar. »Sie gerate ... in den Konflikt, sagte sie, der dadurch entstehe, daß sie ihre Widersacher einerseits geprägt von ihrer Erziehung sehe, andrerseits als Handlanger der Herrschenden verabscheue. ... oft habe sie sich dabei ertappt, daß sie sich noch angesichts dessen, der ihr eben den gröbsten Schimpf zukommen ließ, fragte, wie er zu gewinnen sei.«, /58/ Lotte Bischoff ist eine der wenigen Personen des Romans, die lachen können, auch in Situationen der Bedrängnis. Die mit Rückblenden verschränkte Schilderung ihrer illegalen Rückreise nach Deutschland als blinder Passagier auf einem schwedischen Frachter, die ebenso minutiös die äußeren wie die inneren Vorgänge gibt, entwirft ein ergreifendes Gesamtbild ihrer Persönlichkeit und gehört zu den Passagen des Buches, die am nachhaltigsten Mut machen. Lotte Bischoff ist die zentrale Figur des dritten Bandes, da sie über weite Strecken den Ich-Erzähler ersetzt; es mag nicht unwichtig sein, daß Peter Weiss eine weibliche Figur gewählt hat. Hier kommen feministische Einwände gegen den historisch gewordenen Männlichkeitskult ins Spiel: »Die Männer sahn in der Partei ihr Werk. Die Partei war für die Männer der Boden, um zu wachsen. ... Auch die Männer wollten der Partei ihr Bestes geben. Dabei aber rangen sie untereinander um Vorrechte.« /59/ Solche Atavismen findet Lotte Bischoff lächerlich, auch wenn sie sah, wie verhängnisvoll sich der Kampf der Männer untereinander auswirken konnte, vor allem dann, wenn er »ebenso rasend geführt« wurde »wie der gegen den äußern Feind«. Frei von Verkrampfungen und Verzerrungen, von einer unglaublichen inneren Sicherheit und Zuversicht erfüllt, geht sie an ihre Aufgabe. »Wie war sie durchtränkt worden von Einsichten, wie erleuchtet würde sie sich in ihre neue Region begeben, welcher Kultur, welcher Kunst würde sie dienen, ohne es sich anmerken zu lassen, in gegebnem Fall alles vergessen, so tief vergessen, daß keine Folter es herausholen könnte. Fröhlich, von den Schatten der Lerchen umhuscht, kletterte sie die Leiter empor.« /60/ Es ist für die mimetische Ausstrahlung des Romans ganz besonders wichtig, daß Lotte Bischoff, aktiv beteiligt am illegalen Widerstand in Berlin, den Untergang der Gruppe Schulze-Boysen überlebt und den Kampf fortsetzt. Ihr Überleben hat nicht nur symbolische Bedeutung für die Perspektive des Romans, der mit einem diskursorischen Ausblick auf die kommenden Kämpfe schließt, es bildet zugleich ein starkes mimetisches Gegengewicht gegen die niederschmetternde Mimesis des Schrecklichen: Verzweiflung ist nicht nur nicht das letzte Wort, sondern auch nicht das letzte Bild. Zugleich ist Lotte Bischoff eine weibliche Dante-Figur: Mit ihrer Rückreise nach Deutschland beginnt eine Hadesfahrt. Inmitten des Infernos macht sie Aufzeichnungen, nicht als Beobachter, sondern als Mitkämpferin hindurchgehend durch ein Reich des Schreckens: »Sie wußte, wie schnell das Vergessen immer wieder zusammenschlug über denen, die kämpfend umgekommen waren. ... Deshalb hatte sie alles, was sie vom Dasein und Sterben ihrer Gefährten wußte, in ein kleines Heft eingetragen, das sie jedes Mal wieder unter den Himbeersträuchern vergrub.« /61/
Die von zerreißenden Widersprüchen, von Anfechtungen und Unvereinbarkeiten geprägte, disharmonisch vom Chaos bedrohte Erhabenheit des Widerstands zeigen alle bedeutenden antifaschistischen Werke der sozialistischen Literatur und der anderen Künste. Exemplarisch hierfür sind die Romane von Anna Seghers ebenso wie die Erzählungen von Stephan Hermlin, dessen formgewordene Wertung des Widerstands in seiner schonungslos eingestandenen Widersprüchlichkeit als erhaben in der Vergangenheit vielfach auf Unverständnis gestoßen ist. Daß solcherart Erhabenheit zur entscheidenden Formqualität seiner großen Städteballaden geworden ist, ist ihnen lange Zeit als Manierismus angelastet worden.
zum Seitenanfang
nach oben
Fußnoten:
44 . . Peter Hacks: Essais, Leipzig 1984, S.356.
45 . . Ebenda, S.363/364.
46 . . Ebenda, S.356.
47 . . Peter Hacks: Senecas Tod. Schauspiel in drei Akten. Ebenda, S.23.
48 . . Ebenda, S.59, 44.
49 . . Peter Weiss: Die Ästhetik des Widerstands. Dritter Band, S.50.
50 . . Ebenda.
51 . . Ebenda.
52 . . Ebenda, S.50/51.
53 . . Peter Weiss: Notizbücher 1971-1980, 2. Band, S.782.
54 . . Pseudo-Longinos: Vom Erhabenen, S.99.
55 . . Peter Weiss: Die Ästhetik des Widerstands. Erster Band, S.287.
56 . . Bertolt Brecht: An die Nachgeborenen.
In: Gedichte, Bd. IV (1934-1941), Berlin 1961, S.150.
57 . . Peter Weiss: Die Ästhetik des Widerstands. Zweiter Band, S.82.
58 . . Ebenda, S.118.
59 . . Ebenda. Dritter Band, S.83.
60 . . Ebenda, S. 91.
61 . . Ebenda, S.230/231.
zum Seitenanfang
nach oben
aktuelles über Peter Hacks finden Sie hier:
ARGOS - Mitteilungen zu Leben, Werk und Nachwelt
des Dichters Peter Hacks (1928 - 2003)