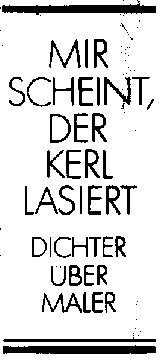
Höhlengleichnis
abgedruckt in
Mir scheint, der Kerl lasiert
– Dichter über Maler
Buchverlag Der Morgen Berlin 1978/1981
Siebenundzwanzig Autoren schreiben über dreißig bildende Künstler
Banause, mag die Cottbuser Malergilde schimpfen. Sie hatte ein ehemaliges Möbelhaus in der Spremberger Straße erobert und darin eine Ausstellung eröffnet. Mit der Uhr in der Hand raste ich an ungefähr fünfundfünfzig Bildern vorüber. Jedes einzelne Werk hätte gut und gern eine Stunde ungeteilter Aufmerksamkeit verdient gehabt. In dreißig Minuten fuhr mein Bus. Gleichsam an bildender Kunst vorüber rannte ich zur Haltestelle. Was dabei in Erinnerung bleibt, ist einer Nachbetrachtung wert. Allmählich formt sich aus dem Sinnesrauschen einander bedrängender, verdeckender, überlagernder Eindrücke ein einzelnes Bild. Es ist ein großes Format, rechteckig, mit ovaler Bildfläche, wie bei alten Fotos. Vier große weiße Ecken mit konkavem Innenrist formen das Bildoval. In diesem Bildausschnitt steht vor geheimnisbraunem Hintergrund ein einfacher Tisch. Auf dem Tisch liegt eine Kopfbedeckung, wie sie Berg-, Bau-, Hütten- und andere Werkleute zum Schutze ihres Kopfes tragen. Neben der weißlich schimmernden Schutzkappe steht eine Thermosflasche. Im Hintergrund, an einem grauen Spind hängt, fast nur angedeutet, in den dunklen Bildgrund übergehend, eine Arbeitsjacke. Der Mensch, dem diese Dinge gehören, ist ausgespart, wenngleich nicht ausgelassen oder gar ausgeschlossen. Sein Geist umflattert in Form von großen weißen Bildecken mit parabolischen Schnittlinien das besinnliche Arrangement.
Aha! Mal etwas anderes. Nostalgisches Format, vorerst und hier noch einmalig, sogar umstritten, daher einprägsam. Verzicht zudem auf das ewige Brigadierporträt beim Thema Arbeiterklasse, Verzicht auch auf ein hundertneunundneunzigstes Brigadebild. Seit Rembrandts "Schützengilde" ist ja gruppenmäßig kaum noch etwas hinzukriegen, auch nicht mit Leuten in Arbeitsklamotten oder Laborkitteln. Seit die sogenannte Spatenforschung eine Wissenschaft ist, wissen wir zudem, daß Artefakte oft mehr und eindringlicher über ihre Hersteller und Benutzer aussagen, als manches Individuum über sich selbst zu sagen wüßte.
Schöpfer dieses wunderlichen Stillebens ist ein gewisser Rainer Mersiowski, wohnhaft in Cottbus, argloser Mensch, Typ des kleinen Mannes auf der Straße, der die Geselligkeit sucht, um der Einsamkeit zu entgehen, die ihn trotzdem immer wieder ereilt, der über sich selbst zu lachen weiß, aber unter dieser dünn-humorigen Kräuselschicht ein zutiefst melancholisches Gemüt verbirgt.
Seine Kompositionen, soweit ich sie kenne, sind einfach, einprägsam, fast schulmäßig. Seine Themen, horizontweite Neubauviertel, ausgekohlte Grubenlandschaften, romantisiert er mit Attributen wie Mondscheinschimmer, einsame Rose, Pfütze mit etwas Himmelsblau drin. Seine Kritiker halten diese subjektivische Romantisierung fragwürdiger Umweltmilieus für unangebracht. Er sagt darauf: Ich sehe das so. Ich male nur, was ich empfinde.
Mir scheint, der Kerl lasiert – Dichter über Maler
Buchverlag Der Morgen Berlin 1978/1981
Siebenundzwanzig Autoren schreiben über dreißig bildende Künstler, so unter anderem:
Rolf Schneider über Werner Tübke, Gerhard Wolf über Carlfriedrich Claus, Peter Hacks über Fritz Cremer, Walter Püschel über Albert Ebert, Eckart Krumbholz über Hans Ticha und Horst Hussel, Günther Rücker über Karl Hermann Roehricht.
Topp ! Assoziationswütigen Betrachtern dürfen seine Gemälde besser nicht allzuoft unter die Lupe kommen. Wer keine Einfälle zuzusetzen hat, sieht freilich nur eben die schlicht empfundene Oberfläche der Dinge, Tisch und Helm und weiße Ecken.
Eine besinnliche Ausstellung des nur zu Alltäglichen? Schon die Bildform, dieses altväterlich feierliche Oval, schließt sogleich jede Alltagsstimmung aus. Die Farbe Umbra dröhnt geradezu vor feierlicher Tiefe. Die gespenstische Abwesenheit des Menschen läßt seine geistige Nähe in einem viel größeren Zusammenhange ahnen und heraufbeschwören als es die paar Gegenstände in einem anderen Rahmen bewirken könnten. Der Mensch, durch Eingebung eines schlichten Gemütes weggelassen, umspannt das dürftige Ensemble nicht nur mit dem Geistergriff der vier weißen Ecken, er steigt soeben aus der Dämmerung. Das dunkle Bildoval wird zum Höhleneingang. Aus feierlichem Höhlenbraun raunt baßtief die Vergangenheit. Die verlängerte Vertikale der Thermosflasche stützt gleichsam das Höhlengewölbe. Die Wölbung der weißlichen Schädelkappe unterstreicht den oberen Ovalbogen, wodurch der Höhlengestus verstärkt wird. Ist das noch ein kompositorischer Zufallstreffer? Ich halte es für den Ausdruck inliegenden Formempfindens mit dem ungewollten Doppeleffekt der Mystifikation. Dem Betrachter schwindet der Bezug zur Gegenwart, um später desto angereicherter zurückzukehren. Der Tisch im Höhlengrund wird zur Arbeitsplattform eines Paläanthropologen. Die Tischbeine übrigens unterhalb der Tischebene verlieren sich wie Wurzeln im Urgrund. Die bleiche Kapsel auf dem Tisch, gemacht zum Schutz der Schädeloberseite des Homo rezens, erscheint als das soeben glücklich aufgefundene Schädeldach eines Neandertalers. Es kostet dem phantasiebegabten Bildbetrachter wenig Mühe, das schmale Schirmchen an der Vorderkappe, dessen Funktion ja der Schutz der Augen ist, für den mächtigen knöchernen Überaugenwulst eines Vormenschen zu halten. Einmal so weit in die assoziative Spekulation hineingezogen, fallen weitere Schlußfolgerungen und zum Schluß das gewinnbeladene Auftauchen aus der Tiefe des Betrachtens nicht schwer. Die Schädelkappe ist leer. Das einstmals um und um geschlossene Knochengehäuse ist an der Basis zertrümmert worden. Nur das robuste Dach hat die Jahrtausende überdauert. Es ist bekannt, daß man vom Frühmenschen zumeist nur diese ganz spezifisch beschädigten Kopfstücke auffindet. In den Fundberichten einschlägig berufener Forscher heißt es nur allzuoft: »Die Unterseite des Schädels war in der Gegend des großen Hinterhauptloches aufgeschlagen!« Dr. Dr. Erhard Schoch, Neue Brehm-Bücher 450, Seite 74.) Oder ebenda, Seite 87: »Um das Gehirn herausnehmen zu können, wurde der Schädel von unten her aufgebrochen.« Oder: »Kein Zweifel, daß hier der Mensch die Schädel von unten her aufgeschlagen hatte, um das Gehirn zu verspeisen !« Ebenda, Seite 131. Und weiter: »Überall (bei mindestens elf anderen Funden, der Autor) war die Schädelbasis aufgeschlagen . . .« Der genannte Verfasser stützt sich dabei auf mehr als zwanzig wissenschaftliche Kapazitäten. Die Fundberichte stammen von verschiedenen, geographisch weit auseinanderliegenden Orten.
Es geht hier nicht um die billige Sensation. Daß unsere lieben Vorfahren Kannibalen waren, daß besonders Hirn ein Leckerbissen war, ist ja bekannt. Ihre Kulturstufe erklärt ihr Handeln. Die Oberschädel der Frühmenschen waren zu dickschalig, ihre Werkzeuge zu bescheiden, das Verfahren zu aufwendig, um frontal an den Fraß heranzukommen. Es erwiesen sich bereits die allerersten Menschen als Rationalisten. Dabei wurde das Oberdach im Handumdrehen zur Schale, zur Hirn-Schale im wahrsten Sinne des Wortes, zum ersten Stück Geschirr vermutlich, das der Mensch benutzte, zum Urbild jeglicher Schalenform. Wer heutzutage aus kunstvoll gefertigtem Nippschälchen seinen Pudding stürzt, der möge das gelegentlich bedenken. Schlecht braucht dabei niemandem zu werden. Des anderen Hirn zu verbrauchen gehörte damals zum guten Ton. Mersiowski malt nur, was er empfindet. Ich schreibe nur, was ich dabei nachempfinde. Kein Wort würde ich darüber verlieren, gäbe es nicht offensichtlich heute noch eine Klasse von Leuten, die zum eigenen Vorteil von der Gehirnmasse anderer leben. Arbeiter, Ingenieur, schütze deinen Schädel nicht nur dort, wo er ohnehin am dicksten ist. Eingebrochen wurde allzeit an der dünnsten Stelle. Schütze dein Bewußtsein auch und vor allem durch eine starke und gesunde Basis. Dieses wäre bei der Betrachtung einer arglos hingemalten Plastekappe durchaus zu bedenken. Verlacht und ausgespottet will ich werden, wenn daran nicht wenigstens ein Körnchen Wahrheit ist.
Mir scheint, der Kerl lasiert – Dichter über Maler
Buchverlag Der Morgen Berlin 1978/1981
Siebenundzwanzig Autoren schreiben über dreißig bildende Künstler, so unter anderem:
Rolf Schneider über Werner Tübke, Gerhard Wolf über Carlfriedrich Claus, Peter Hacks über Fritz Cremer, Walter Püschel über Albert Ebert, Eckart Krumbholz über Hans Ticha und Horst Hussel, Günther Rücker über Karl Hermann Roehricht. Außerdem bereichern ein Anhang mit PorträtFotos der bildenden Künstler von Christian Borchert sowie eine fragelustige Nachbemerkung des Herausgebers diesen Band.