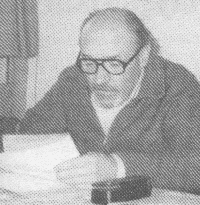Sisyphosarbeit
von Armin Stolper
in: »Theater der Zeit« Heft 8/1983
Wer die Götter überlistet und sogar dem Tod ein Schnippchen schlägt, der verdient eine Strafe, die sich nach antiker Überlieferung in einer besonderen Form von Schwere und Sinnlosigkeit ausdrückt. So geschehen dem griechischen Sagenhelden Sisyphos, der für sein listenreiches Tun in der Unterwelt dazu verdammt wurde, einen Felsbrocken gigantischen Ausmaßes den Berg hinaufzuwälzen, von dem er jedesmal, bevor er den Gipfel erreicht, wieder hinabrollt. Auf der Kupfertafel, die Karl Philipp Moritz in seiner »Götterlehre« kommentiert, ist unter dem Schwerarbeiter Sisyphos das Paar Amor und Psyche, »sich umarmend dargestellt.« In seinem Stück »Der verwunschene Berg« greift Erich Köhler den Mythos vom Sisyphos auf, behandelt ihn aber auf zeitgenössisch-sozialistische Weise, d. h., er funktioniert ihn um. Freilich muß man sich das nicht so lehrhaft-didaktisch vorstellen, wie es die notwendigerweise kürzelhafte Formulierung suggeriert. Köhler ist ein phantasievoller, leidenschaftlicher Poet, der uns schon mehr als einmal mit seinen erzverrückten Geschichten von verbohrten Einzelgängern wie mit seinen sarkastisch-aufsässigen Essays aus der oft biedermeierlichen Eintracht und Ruhe scheinsozialistischer, nichtrealistischer Behaglichkeit aufscheuchte. Daß er sich in dieser Geschichte mit dem alten Mythos aufs neue und auf neuartige Weise herumschlägt, wird nur denjenigen verwundern, der seinen letzten Beitrag, veröffentlicht in »Sinn und Form«, 1982/5, nicht gelesen hat.

Köhler zieht dort gegen die sogenannte homerische Tradition in der Kunst und deren Überlieferung zu Felde, die sich von jeher in der Schilderung und Lobpreisung von kriegerischem Tun gefiel; er bricht zugleich eine Lanze für Hesiod, der in seinen Werken vorwiegend die friedliche Arbeit des Menschen, sein schöpferisches Tun, pries und dafür lange nicht den Ruhm seines künstlerisch gleichrangigen Kontrahenten errang: »Mindestens zwei Drittel der vor Troja handelnden Achaier waren, recht besehen, Faulpelze, Neidhammel, Protze, Intriganten, Schläger, Mordbrenner, eifersüchtige Hahnreis, aggressive Tunichtgute, halbwilde Hirtenhäuptlinge mit dem fragwürdigen Verdienst pränationalistischer Kolonisatoren, die in Friedenszeiten nichts mit sich anzufangen wußten und denen jeder Feldzug gerade recht war, sich auf Kosten der jeweils überfallenen Ackerbaugesellschaft in Szene zu setzen.« Köhler meint, daß sich ein dem Hesiod verpflichteter Dichter unserer Tage eine »mythologisierende Kosmetik« nicht leisten könne: »Sein Lied profitiert nicht aus der hektischen Spannung des Waffenganges. Zwischen Geburt und Tod schwingt hier ein breites Feld der täglichen Bewährung ... Wenn hervorragende Arbeiter, Forscher, Kollektive geehrt und ausgezeichnet werden, so ist das ein deutlicher Hinweis auf die geschichtliche Bewegungsrichtung. Edel ist nicht, was zuvor des gewaltsamen Todes bedarf, um allgemein interessant zu werden, sondern das Bekenntnis zur lebendigen, schöpferischen Arbeit.«
Eben dies, die schöpferische Arbeit, wird zum zentralen Thema in Erich Köhlers Stück »Der verwunschene Berg«, das der Dichter als »einen Bühnenvorschlag« nach seiner Filmerzählung »Hartmut und Joana« schrieb, nach der zwar nie ein Film gedreht wurde, die aber nun, in »Sinn und Form« vorabgedruckt, bereits in zweiter Buchauflage beim Hinstorff Verlag erschienen ist. Seinen Helden, den Transportarbeiter Hartmut Wagner, läßt Köhler durch eine seiner Stückfiguren folgendermaßen charakterisieren:
Ernährst keine Familie
sparst nicht auf ein Auto
du hast noch immer keine Neubauwohnung
baust keine eigene Datsche
spielst nicht im Lotto
züchtest keine Karnickel
säufst unregelmäßig
fährst nie in Urlaub
verschenkst dein Geld
mußt nicht einmal Alimente zahlen
Junge, ich glaube, du bist nicht von hier.
Aber das Untypische an dieser recht typischen Arbeiterfigur wird noch weiter getrieben, wenn dieser Mensch des harten Mutes nicht nur einem Kindertraum nachjagt, sondern ihn sogar zu verwirklichen trachtet. Inmitten einer im Umbruch begriffenen Landschaft, in der Industrieanlagen und Wohnstadt zur gleichen Zeit aus dem Boden gestampft werden. Da wird viel Erde bewegt und genau das ist der Grundstoff für die Traumrealisation unseres Helden; damit baut er einen Berg inmitten der Ebene, ganz allein, sehr mühselig, bemitleidet von manchen, verhöhnt von vielen; diesem Berg opfert er sein ganzes Leben und seine ganze Liebe, und wenn der eines Tages rasiermesserhaft und blitzesschnell hinwegrationalisiert wird, dann ist er selbst zwar ein toter Mann, aber sein Traum ist nicht totzukriegen. Er beschäftigt die Nachwelt so sehr, daß ein neuer Berg errichtet werden muß; diesmal mittels staatlicher Planung, in Form kollektiver Arbeit, mit Hilfe fortgeschrittener Technik.
Also ein Stück nach dem berühmten Muster: Einer gegen alle? Ja und nein. Köhler liebt seinen Helden und stattet ihn mit vielen Elementen aus dem Reservoir trotzigprovokanter Selbsthelfer aller Zeiten aus, er läßt ihn zum Träger und Realisator seiner Hauptidee werden, aber er stellt ihn doch nicht gegen eine ihm feindlich gesonnene Umwelt, sondern mitten hinein in eine Gemeinschaft von Gleichen, deren Vertreter allerdings keineswegs so hartnäckig von der Notdurft einer Traumerfüllung gepeinigt werden, wie er selbst. In einer Zeit, in der für die Notwendigkeiten der vielen so vieles auf einmal geschafft werden muß, bleibt das Tun für den Überfluß gewissermaßen noch die Angelegenheit einzelner. Und der Härte dieser Zeit und ihrer oft ad hoc durchgeführten Auf- und Umbrüche ist es zuzuschreiben, wenn dabei vieles von dem gewollten und proklamierten Ideal vorerst nur bei einem einzelnen in festen Händen liegt, der für die Schaffung des Surplus sogar noch immer mit seinem Leben bezahlen muß. Natürlich bringt ihn keiner um, aber es bringt ihn um; er geht an der Un-Menschlichkeit der sich selbst gestellten Aufgabe zugrunde und müßte es doch nicht in einer Gesellschaft, die sich der Menschlichkeit verpflichtet fühlt. Oder doch?
Aber dieser Hartmut Wagner hat auf höherer Ebene einen Kontrahenten, der eigentlich kein Gegenspieler ist, sondern gleichfalls wie er einem schier unerfüllbarem Ziel nachjagt, nämlich: eine neue Stadt kulturfähig zu machen. Der Er ist eine Sie, hervorgegangen ebenfalls aus der Arbeiterklasse, hochstudiert bis zum OB der Stadt, in der Wagner seinen verwunschenen Berg errichtet. Joana, von Hartmut geliebt und ihm immer entschwindend, weil er mit seinem Berg mehr befaßt ist als mit der Frau, die sich von ihm fortbewegt, weil ihre Aufgabe sie dazu mit ebensolcher Notwendigkeit zwang; wiederum ein an sich tragischer Vorgang, denn nicht einmal die Liebe vermochte diese beiden Menschen zueinander zu führen in einer Zeit, die doch für Liebende schon günstiger ist hierzulande als alle ihre Vor-Zeiten.
Für mich ist es von besonderem Interesse, daß der Dichter auch in dieser Figur eigentlich eine Arbeit von sisyphoshaftem Ausmaß Gestalt werden läßt, aber diesen Begriff auch bei Joana einem neu- und andersartigem Denken unterwirft. »Du leugnest den Materialismus«, hält Joana Hartmut vor und fährt fort: »Schuften bis zum Umfallen als Lebensideal. Du verhöhnst den Fortschritt. Du entstellst den Sinn der Arbeit. Der Mensch braucht den Erfolg. Er will für seine Arbeit etwas haben ... Erde buckeln. Was ist das schon für eine Leistung. Kann man dafür Rohstoffe, kann man dafür Genußmittel kaufen, Kaffee, Bananen. Kriegen wir dafür Baumwolle. Hilft uns das, die Energiefrage lösen. Bringt uns das bessere Planungs- und Leitungsmethoden? Ja, freilich, wenn jeder sein Leben lang bis zum Umfallen Erde schleppen soll, dann braucht die Menschheit keinen Fortschritt, keine moderne Technik, keine Elektronik, keinen Handel, keine Leitung, keine Kultur, nichts, gar nichts ...«
Köhler polemisiert also mit seinem Berg nicht billig gegen die technisch-wissenschaftliche Revolution im Sozialismus, aber er läßt im Leser seiner Geschichte, im möglichen Betrachter seines Theaterstückes, die Erkenntnis reifen, daß dem gesellschaftlichen Fortschritt etwas Wesentliches fehlt, wenn der in den Ebenen, wo keine Berge vorgesehen sind, keine Berge entstehen läßt. Er läßt auch Trauer aufkommen darüber, daß ein Lebenswerk bedenkenlos vernichtet wird und daß ein auf Beschluß von oben rasch hergestellter Ersatz-berg nicht das gleiche bedeutet wie ein Individualberg, in den der Mensch sein ganzes Leben, in dem der Mensch in seiner Gänze steckt. Die Ebenen haben miteinander zu tun, aber sie sind nicht identisch. Hartmut und Joana sind potentiell Liebende, deren Liebe sich jedoch nicht erfüllt. Dies ist freilich nur ein Gesichtspunkt des Stückes, und ich möchte selber nicht mehr darauf herumreiten als nötig; keinesfalls sollte er andere Lesarten ausschalten oder für unzulässig erklären.
So schwer wie es Köhler seinen Protagonisten im Stück macht, so schwer wird es sein Stück haben, in überzeugender Weise auf eine Bühne unseres Landes zu kommen, denn wieder einmal haben wir es mit einem dramatischen Werk zu tun, das das Theater nicht eilfertig bedient, sondern es herausfordert in seiner ganzen ihm möglichen schöpferischen Potenz. Wenn da von Mitteln der Symbolik und des Grotesken die Rede ist, kann ich mir die Ratlosigkeit der Regisseure, Bühnenbauer und Dramaturgen gut vorstellen, behalten sie doch mit schöner Einseitigkeit diesen Mittelfonds zumeist den Stücken der Vergangenheit oder aus exotischen Zonen des Planeten vor. Wer da die Finger von dem heißen Eisen läßt, muß nicht ein feiger Hund geheißen werden, aber wer sich der Aufgabe stellt, diesen »Verwunschenen Berg« auf seiner Bühne zu errichten, den wird man sicherlich nicht dekorieren, doch ist er gewissermaßen selber in die Reihe der modernen Märtyrer und Wundertäter eingetreten, deren Zahl nicht gerade groß ist. Von Sisyphosarbeit auch bei der Realisierung des Stückes auf der Bühne zu sprechen, scheint mir berechtigt, denn es werden viel kluge Leute zur Hand sein, die einem beweisen, daß man sich dabei in ähnlich verzweifelter, schier auswegloser Lage befindet wie Hartmut und Joana.
Wer von den Theaterleuten trotz dieser Warnung den Mut nicht sinken, sondern sich von ihm durchpulsen läßt, dem sei empfohlen, gewissermaßen als Kontext zu dem hier vorliegenden Stück, Erich Köhlers »Paralipomena« zu lesen, die ebenfalls in »Sinn und Form, 1980/5« veröffentlicht wurden. Und sei es nur zu dem Zweck, um über den Satz nachzudenken, der dort inmitten einer hinreißend geschriebenen Polemik gegen die bürgerliche Kriminalliteratur für die Entwicklung der sozialistischen Weltliteratur steht, der da lautet: »Aber fabriziert die volkseigene Getränkeindustrie um des Umsatzes willen nicht vorzugsweise gezuckerte Weine, weil der herbe, naturgegebene Rebensaft allgemein als sauer verkannt wird?«
Hätte ich als Dramaturg einer möglichen Aufführung des Stückes das Programmheft zu gestalten, würde ich auf dessen Titelblatt die eingangs erwähnte Kupfertafel abbilden: oben Sisyphos bei der Arbeit, unten Amor und Psyche bei der Liebe. Der aus dem Altertum herrührende Widerspruch mag. den zeitgenössischen Betrachter provozieren, aktivieren, amüsieren - so wie Köhlers Stück.
Sisyphosarbeit
Zu Erich Köhlers
»Der verwunschene Berg«
Von Armin Stolper
erschienen in: »Theater der Zeit« Heft 8/1983
Foto oben: Kneschke
außerdem sind folgende Personalien aufgeführt:
Erich Köhler
Geb. 1928, erlernter Beruf Bergmann. Arbeitete als Füller, Fördermann, Hauer und Steiger bei der Wismut-AG, war aber auch Sägewerksarbeiter, Landarbeiter, Genossenschaftsbauer sowie Absolvent des Instituts für Literatur »Johannes R. Becher«. Seit 1963 freischaffender Schriftsteller. Lebt im Spreewald.
Epik (Auswahl): »Schatzsucher« (1964), »Nils Harland« (1968), »Der Krott« (1976), »Hinter den Bergen« (1976), »Hartmut und Joana« (1980), eine Filmerzählung, bildete die Grundlage für »Der verwunschene Berg«. Mehrere Kinderbücher.
Stücke: »Die Lampe« (Einakter - 1970 U am Deutschen Theater), »Der Geist von Cranitz« (1972 U an der Volksbühne, abgedruckt in TdZ 7/72), »Vietnamesische Legende« (1975 U Theater der Freundschaft), »Das kleine Gespenst« (1977 U Theater der Freundschaft).